Manfred Klimek, der tolle Fotograf aus Wien, ist schon mehrmals in diesem Blog aufgetreten. Zuletzt bot seine Wiener Ausstellung „Das war Manfred Klimek“ im letzten Herbst den Rahmen für eine Lesung des MAC. Klimek ist einer, der sich kein Blatt vor den Mund nimmt. Das untenstehende Interview, das zuerst in WELT online erschienen war, sorgte auch gleich für Wirbel, den die „Süddeutsche Zeitung“ in ihrer heutigen Ausgabe auf fast einer ganzen Seite groß auswalzt. In dem Ärger, den es nun um den Text gibt, droht unterzugehen, dass Klimek in seinem Selbstgespräch ein sehr treffendes und differenziertes Bild zeichnet über den Niedergang der alten „Medienbranche“. Lest selbst!
Der Text steht im MAC Blog am Beginn einer Folge von Artikel in loser Folge, die den Wandel im Journalismus behandeln. Nächsten Freitag: Was wurde aus dem linken Journalismus – eine Frage, für die sich der MAC selbst sehr zuständig fühlt.
BERUF REPORTER
Von Manfred Klimek
Der Fotograf Manfred Klimek hat mehr als dreißig Jahre für große, deutsche Magazine gearbeitet. Hier spricht er über über die massiven Veränderungen der Branche. Und erinnert sich an Zeiten, die so nie wieder kommen werden. Das Interview mit ihm hat er selbst geführt.
Herr Klimek, wie geht es Ihnen?
Das wissen Sie doch, wir sind ja heute morgen gemeinsam aufgestanden.
Nun, das ist vielleicht nicht der richtige Ort, das auszubreiten. Kommen wir doch gleich zu Ihrem Werk als Fotograf für ein paar der wichtigsten deutschen Magazine, Nachrichtenmagazine und Wochenzeitungen wie Stern, Spiegel oder Die Zeit.
Ist das nicht ein banal erwartbarer Einstieg in ein Interview?
Sie kennen meine Frage dazu gar nicht.
Mir dämmert, dass Sie Anekdoten hören wollen. Also Alte-Weiße-Mann-Geschichten aus einer Zeit im Journalismus, als alles besser war.
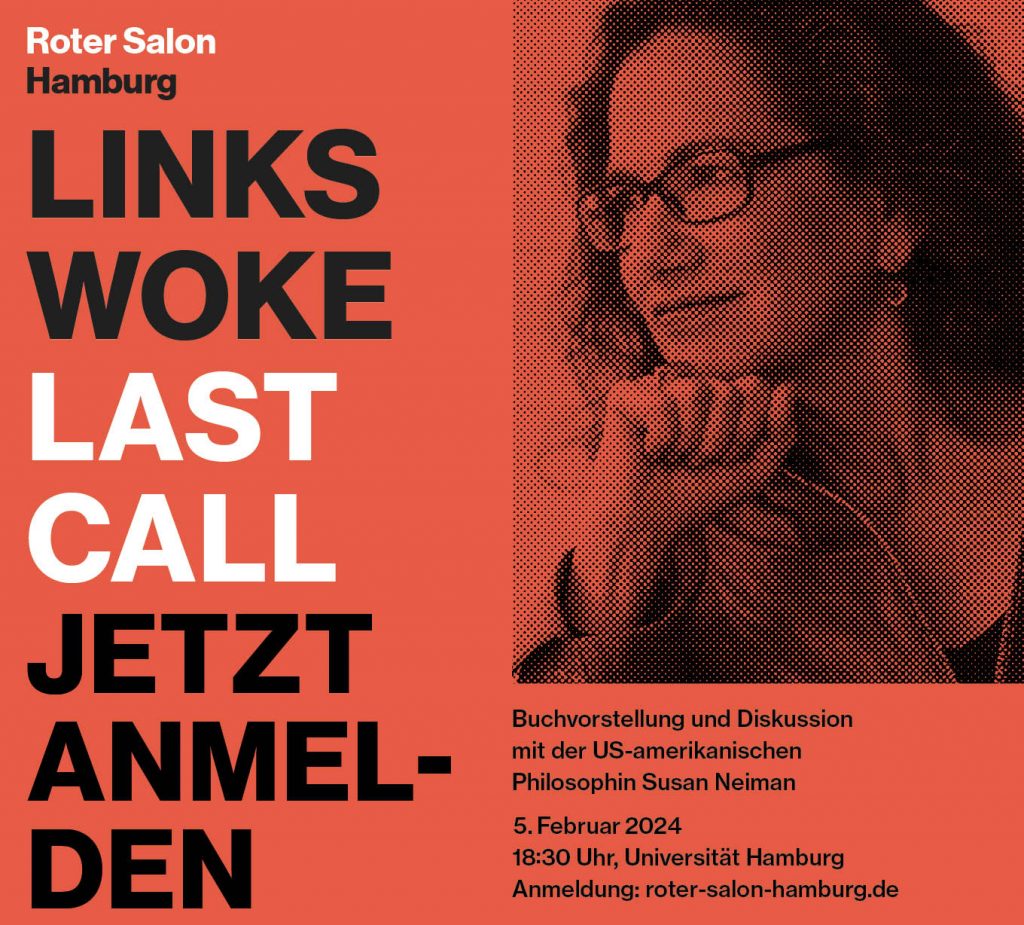
Und genau das wäre meine Frage gewesen und ist meine Frage: War denn früher alles besser im Journalismus?
Besser nicht. Aber anders. Leichter und schwerer zugleich. Die Digitalisierung hat den Einstieg in die Medien- und Zeitschriftenfotografie ab etwa 2000 umfassend demokratisiert. Mein Ausrüstung, die ich mir mit dem ersten verdienten Geld kaufte, da war ich 22, diese Ausrüstung, Nikon, Hasselblad, Leica und eine doppeläugige Rolleiflex, kostete am Gebrauchtmarkt schon mehr als 10000 Mark. Und dann kamen noch die Kosten für Filme dazu; vom Entwickeln und Printen ganz zu schweigen. Da haben es Fotografinnen und Fotografen heute leichter bei den Einstiegs- und Erhaltungskosten. Nur verdienen sie kaum bis gar kein Geld mehr bei Medien. Und auch anderswo nicht. Mein Beruf, die Autorenfotografie, ist tot.
Ist das nicht dramatisch resignativ? Wenn ich den World-Press-Award betrachte, dann sehe ich dort jedes Jahr sehr viele hochwertige, spannende Fotos von teils exzellenten Fotografen.
Stimmt. Können Sie mir Namen dieser Fotografen nennen? Welche Agentur sie repräsentiert? Welche Galerie ihre Fotos handelt?
Nein, kann ich nicht. Also nicht auf Anhieb.
Genau. Jetzt kennen Sie den Unterschied zwischen dem Gestern und dem Heute.
Wie war ihr erster Tag im deutschen Journalismus?
Grotesk. Ich war 23 und in Österreich schon etabliert, weil ich bereits zwei Jahre bei einer Illustrierten namens WIENER gearbeitet hatte, die europaweit in Sachen Journalismus, Art-Direktion, damals noch „Layout“ genannt und auch in Sachen Fotografie absolut Kult war. Dass dieser Aufbruch in die journalistische Moderne ausgerechnet aus Wien kam, hat viele erstaunt. Der WIENER war aber nichts weiter als eine neue Variante der deutschen 68er-Provo-Zeitschrift Twen, die mit Willi Fleckhaus einen der besten Gestalter der deutschen Medienlandschaft beschäftigte. Und mit Will McBride einen der besten Fotografen. Siebeck übrigens …
… Wolfram Siebeck, der kulinarische Großkritiker des Zeit-Magazin …
Genau! Siebeck hat McBride die Frau ausgespannt. War damals sogar in der Bunten.
Und genau dort gehört das auch hin.
Wir aber wollen zurück zu ihrem ersten Tag im deutschen Journalismus.
Ah, ja. Also kein Gossip. Gut: Ich bin im Herbst 1985 vom Stern angesprochen worden. Die haben mich angerufen und ein Ticket geschickt, das ich im Wiener Büro abholen musste. Ich bin dann mit dem Nachtzug hoch und ungeduscht in diesem riesigen Verlagshaus eingeritten, das größer war als das größte österreichische Verlagshaus. Ich hatte einen Termin mit dem damaligen stellvertretenden Chefredakteur Dieter Gütt, der mich empfing und total verwirrt war.
Weswegen?
Weil die keinen 23jährigen Starfotografen erwartet haben, sondern jemand, der in ihrer Erwartung deutlich älter zu sein hatte. Mich hat auch gewundert, dass mich nicht der „Fotochef“ empfing, wie man damals die Ressortleiter Fotografie nannte, sondern ein Vertreter der Chefredaktion. Gütt holte dann telefonisch den Ressortleiter Lifestyle hinzu, Michael Jürgs, der schon ein Jahr drauf Stern-Chefredakteur und danach ein bedeutender deutscher Biograf wurde. Das alles schien mir absurd unangemessen.
Bis ich draufkam, denen ging es gar nicht um mich: die wollten mich nur ausfragen, wie wir das beim WIENER so machen. Warum wir so genial waren. Sie dürfen nicht vergessen, dass der Stern und der ganze Gruner-&-Jahr-Verlag noch mit den Nachwehen der Hitler-Tagebuch-Affäre zu kämpfen hatte..
… der Fälschung angeblicher Aufzeichnungen von Adolf Hitler …
Genau. Die Auflage war im Keller und am „Affenfelsen“, so hieß das Hautquartier des Stern damals, suchte man Antworten bei Mitarbeitern von Zeitschriften, die quasi über Nacht legendär und auflagenstark wurden. Und Gütt und Jürgs dachten, bei einem Fotografen des WIENER, bekämen sie darob Auskunft. Ich habe aber, als die Fragen genau wurden, einfach cool gegrinst und die Gegenfrage gestellt: „Sie glauben doch nicht im ernst, dass ich hier Betriebsinterna ausplaudere?“ Danach war der Termin auch beendet.
Das waren ja dann sinistre Absichten.
Kann man so sagen. Als sie erkannten, dass das nichts wird, haben sich mich in die Fotoredaktion abgeschoben. Für Gütt war ich fortan Luft; Jürgs aber, das muss ich sagen, hatte irgendwie ein schlechtes Gewissen und hat der Fotoredaktion gesagt, man solle bitte einen Vertrag mit mir machen.
Sie bekamen also einen Vertrag mit dem Stern, damals die führende Illustrierte Europas, weil die ein schlechtes Gewissen hatten?
Ja, so wird es wohl gewesen sein. War mir aber egal. Ich war 23 und beim Stern. Mehr kann ein Fotograf nicht erreichen, dachte ich. Doch das war ein Irrtum.
Warum?
Weil ein 5000-Mark-im-Monat-Vertrag zwar nach viel klang, für den Stern aber gleichbedeutend mit Null war. Trotzdem gaben die mir einen gleich einen großen Auftrag: Ich sollte zum 30ten Jahrestag der ungarischen Revolution schon im Dezember 1985 damit beginnen, die bekanntesten ungarischen Revolutionäre, Männer wie Andras Hegedüs, im Wiener oder Pariser Exil zu fotografieren. Das verschob sich aber auf Sommer 1986, als sie endlich einen Redakteur gefunden hatten.
Dieser Redakteur wohnte bei seinem Wien-Aufenthalt wochenlang im teuersten Hotel der Stadt, dem Palais Schwarzenberg. Als ich ihn das erste Mal traf, schickte er mich gleich wieder weg: Ich sollte eine Krawatte kaufen gehen, bevor ich mit ihm Termine wahrnehmen dürfe. Ich habe dann in Hamburg angerufen und gefragt, ob dieser Typ völlig pleplem wäre – eine richtige Majestätsbeleidigung, wie ich erst viel später erfuhr. Nun, nach einigen Telefonaten durfte ich dann ohne Krawatte mit ihm arbeiten. Der Kompromiss war, dass ich meinen neuen Anzug von Helmut Lang anzog, der natürlich um Etliches schicker war, als seine Imitation eines englischen Lords. War auch nicht gut für’s Arbeitsklima
Und wurde es trotzdem eine gute Story?
Ja. Sie erschien nur nie. Denn als sie fertig war und ich dutzende Prints nach Hamburg geschickt hatte, da meldete sich der damalige Chefredakteur Rolf Winter und ließ ausrichten, ein anderer Autor, ich glaube mich dunkel aber unsicher an Peter Scholl-Latour zu erinnern, sollte diese Geschichte schreiben. Die Fotos wurden von der prominenten Pariser Fotoagentur Magnum zugekauft. Die wochenlange Arbeit war also, wie man in Wien sagt: „für den Hugo.“ Der Redakteur war ordentlich deprimiert – konnte ich ihm nicht verdenken.
Danach hat mich der Stern bei einem Projekt namens Fritz geparkt, eine junge Illustrierte, die Gruner & Jahr auf den Markt bringen wollte, aber nie damit fertig wurde. Da habe ich dann noch ein paar Geschichten für die Schublade fotografiert, bevor ich das Handtuch warf. Wie man mir später sagte, war ich der erste Fotograf überhaupt, der beim Stern hinschmiss.
Ihr Eindruck ihrer Zeit beim Stern?
Menschen mit irre viel Geld und überhaupt keinen Plan.

Sie sind ja dann nochmals als Fotograf zum Stern zurück.
Ja, 1999 bis 2005. Das war eine große Zeit. Wichtige Portraits und Reportagen. Und alle, ausnahmslos alle, sind erschienen. Ich arbeitet mit gleichaltrigen, auch mit jüngeren Kollegen, aber auch mit Autorenlegenden wie Uschi Neuhauser oder Niklas Frank. Von diesen Leuten lernte ich viel. Am meisten von dem auf Interviews spezialisierten Kollegen Sven Michaelsen, mit dem ich auf Werner Herzog oder Woody Allen angesetzt wurde – allesamt für eine Fotografenkarriere wichtige Termine.
Michaelsen war es übrigens, der mir einen Witz und eine Anekdote über den Stern erzählte. Der Witz ging so: Wie begeht ein Stern-Redakteur Selbstmord? Er wirft sich von seinen aufgetürmten Geschichten, die nie erschienen sind in die Tiefe.
Und die Anekdote?
Beim Stern wurden deswegen so irre viele Spesen gemacht, weil der legendäre Stern-Herausgeber und Chefredakteur Henri Nannen den damaligen Stern-Eigentümer, den Zeit-Verleger Gerd Buccherius, der als Pfennigfuchser in Verruf war, bis zur Weißglut ärgern wollte.

Der Stern war ja nicht ihre einzige fotografische Basis in Deutschland.
Stimmt, ich arbeitete auch für den Spiegel und Die Zeit. Bei der Arbeit für den Spiegel, wo Fotografie gerade erst einen Stellenwert bekam, bleibt mit der Termin mit Marcel Reich-Ranicki und seiner Frau Teofila in Erinnerung. Ranicki bellte mich sofort an und nieder und ich drückte einfach ab. Aber als seine Frau ins Bild kam, ließ er das Bellen sein und die Maske fallen. Das waren die besten Fotos. Und das hat der große Ranicki während des Fotografierens auch gut erkannt. Mich rief nach Erscheinen der Geschichte und der Fotos jemand aus der Chefredaktion an, um mir zu den Bildern zu gratulieren. Das war in Wien öfter mal der Fall gewesen – kostet nichts und macht gutes Klima -, beim Spiegel jedoch, so sagte mir später der Fotoredakteur, sie das bis dahin nie der Fall gewesen.
Kommen wir zur Gegenwart, zum Verlust des Vertrauens der Bevölkerung in die Qualitätsmedien des Landes….ein Verlust, der in Deutschland sehr ausgeprägt ist.
Mehr ausgeprägt als anderswo?
Ich kann nur mit einem direkten Vergleich meines Geburtslandes Österreich antworten. Selbstredend gibt es auch dort eine Personenschaft, die Qualitätsmedien und dem österreichischen öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten nicht nur mit Vertrauensverlust, sondern mit kollektiver Ablehnung begegnet. Und auch in Österreich gibt es die gleichen Vorträge über die Linkslastigkeit dieser Medien und das Verschweigen unangenehmer Wirklichkeiten zum Beispiel in Angelegenheiten der Migrationspolitik …
… sie sagen „Wirklichkeiten“. Warum nicht „Wahrheiten“?
Weil Wahrheiten immer interpretierbar sind. Wirklichkeiten aber selten. Meiner Meinung nach arbeiten betont qualitative Medien diesen Unterschied zwischen Wahrheiten und Wirklichkeiten nur ungenügend aus. Es muss deutlicher zur Geltung kommen, dass Wirklichkeiten Fakten sind, dass Wirklichkeiten verbrieft Eingetretenes ist. Und nicht vermutet Wahres. Es kann also keine Fakten geben, die der Wahrheit entsprechen, wenn diese Wahrheit keine Prüfung durch die Wirklichkeit erfahren hat.

Kommen wir zurück zu Österreich. Was ist dort anders?
Die Zahl der Zweifler an der Seriosität der Qualitätsmedien ist merkbar geringer als in Deutschland. Merkbar geringer auch bei den Anhängern der rechtsextremen FPÖ, die ja stets Zweifel an der Richtigkeit der Berichte linksliberaler, öffentlich-rechtlicher und auch konservativer Medien streut. Aber zuletzt nahmen selbst eingefleischte Anhänger der FPÖ Berichte über Skandale der FPÖ für bare Münze. Der Strache-Ibiza-Skandal im Mai 2019 etwa, der zum Sturz der Regierung in Wien führte, wurde auch von ultrarechten Medienkonsumenten nicht angezweifelt, obwohl an Teilen der Recherche auch das links-bürgerliche Wochenmagazin Falter beteiligt war. In deutschen Foren konnte man aber über Wochen lesen, dass es sich hier um eine Lügen-Intrige gegen Strache und den damaligen, in Deutschland mehr noch als in Österreich verehrten Kanzler Sebastian Kurz handeln muss.
Und warum ist das so? Können die Österreicher nicht nur Fußball besser, sondern auch Medien?
Nun, das werde ich sicher nicht behaupten, weil es keiner Wirklichkeit entspricht, zudem die Medienlandschaft in Wien und den Bundesländern eine sehr eingeschränkte Vielfalt bietet. Aber so Kardinalfehler, die das Vertrauen der Medienkonsumenten massiv beschädigen wie es in Deutschland der Fall ist, die geschehen in Österreich und anderswo in Europa selten bis gar nicht.
Kardinalfehler also. Das bedeutet Fehler, die schwer rückgängig zu machen sind; Fehler zudem, die andere Fehler mit sich ziehen. Da können Sie vielleicht mit einer Antwort helfen, welche das gewesen sein sollen.
Nun, neben der Relotius-Affäre, die den Qualitätsjournalismus bis heute noch der Unglaubwürdigkeit zeiht, ist das vor allem die Affäre um die Silvesternacht 2015/2016, als in Köln Jugendliche mit Migrationshintergrund Mädchen und Frauen auf dem Hauptbahnhof in großer Zahl sexuell belästigt haben sollen.
Warum sollen?
Weil es trotz Augenzeugen kaum zu Anklagen kam. Mein Vorwurf des Verspielens von Kreditwürdigkeit fußt darauf, dass die öffentlich-rechtlichen Medien über den Vorfall erst Stunden, wenn nicht sogar Tage später berichteten. Was Sie aber hier anführen, ist die nicht uninteressante Aufzeichnung zweier Wirklichkeiten. Erstens die Wirklichkeit der dort belästigten Frauen. Zweitens die Wirklichkeit der Justizermittlungen. Das Interessante daran ist, dass die Wirklichkeit der Frauen in feministischen und linken Foren in den Sozialen Medien bezweifelt wurde. Und die Wirklichkeit der Justizermittlungen in den ultrarechten Foren. Beide Parteien, in Zuspitzung gefangen, ergingen sich, beide Wirklichkeiten den Gesetzen ihrer eigenen Wahrheit zu unterwerfen.
Und?
Und? Das ist doch klar: In einem solchen Fall müssen Medien schnell und faktenbasiert berichten. Ohne zu werten. Das haben die öffentlich-rechtlichen Medien auch getan. Aber eben Stunden bis Tage später. Und damit haben sie ihre Glaubwürdigkeit verspielt, ohne dieses Verspielen in Folge richtig zu bewerten und aufzuarbeiten. Seit jener Silvesternacht gibt es in Deutschland, vor allem in den so genannten neuen Bundesländern, eine große Anzahl Bürger, die den öffentlich-rechtlichen Medien, wie eigentlich allen Medien, generell misstrauen. Da ist großer Schaden angerichtet worden, der schwer zu beheben ist. Jahre später noch. Ein Kardinalsfehler eben.
Sie leben schon länger in der Bundesrepublik und arbeiteten und arbeiten vor allem für deutsche Medien. Was sehen Sie als Gründe, warum diese Medienskandale, genannt wurden Relotius und der Silvester 2015/2016, Ihrer Meinung nach vor allem in Deutschland Platz greifen.
Ich arbeite für deutsche Medien erst verglichen kurz als Autor – ein späte, zweite Karriere. Doch in meiner ersten bundesdeutschen Medienlaufbahn als Fotograf für Stern, Spiegel, Die Zeit und Zeit-Magazin fiel mir eben auf, dass im neueren deutschen Journalismus zwei Gefühlslagen mit vorherrschen, die dem Journalismus nicht zuträglich sind. Die erste dieser Gefühlslagen war lange jene, und ist es noch, schon zwänglerisch moralisch und gesellschaftlich bildend sein zu müssen – und das betrifft nicht nur linksliberale, sondern auch rechtsliberale Medien.
Und das war früher anders?
Das war früher insofern anders, dass man den Medienkonsumenten zutraute, selber Fakten bewerten zu können, ohne dass es dazu noch Hinweise oder gar einen Kommentar braucht.
Und die zweite Gefühlslage?
Das ist die der Angst: die Angst, nicht einen Platz auf der gesellschaftlich, moralisch und politisch richtigen Seite Platz zu besetzen. Und die Angst, durch Auffälligkeiten, auch durch Ambivalenz, die zum Menschen gehört, derart aufzufallen, dass eine Karriere darunter leiden könnte. Und dass diese Angst greift, das ist den Sozialen-Medien zu verantworten, dem dort aufgerufenen Gerichtshof und der Medienkrise generell, die ihre Ursachen nicht nur in den Sozialen Medien findet – aber eben auch.
Wir leben nicht mehr nur in Zeiten eines Journalismus, der ausschließlich von Wirklichkeiten erzählt und der lediglich Fakten aufführt, wie es früher meist gang und gäbe war; wir leben nun in einem Journalismus, der von Klickraten stärker dominiert wird als von verkauften Exemplaren und einer harten Auflage. Wir leben in einem Journalismus, der sich stark an starken Meinungen orientiert, anstatt der starken Wirkkraft von Fakten alleine zu vertrauen.
Ja, gibt es diese Wirkkraft von Fakten überhaupt noch?
Es gibt sie nicht bei jenen Personenschaften, die von Qualitätsmedien überprüfte Fakten samt und sonders ablehnen. Und mir fällt auch wenig bis nichts ein, das diese Menschen wieder zu Fakten und den Wirklichkeiten von Fakten zurückholen könnte. Aber die Antwort kann nicht sein, zu diesen Fakten auch dutzende moralische Meinungskommentare abzusondern, wie etwa im Fall Aiwanger …
… dem stellvertretenden bayrischen Ministerpräsident, der 2023 verdächtigt wurde, vor Jahren ein antisemitisches Pamphlet in Umlauf gebracht zu haben.
Ja, das konnte so, wie es gehandhabt wurde, nur schiefgehen und dazu führen, dass die lobenswerte deutsche Politik-Rücktrittskultur ein Ende fand. Die Meinungskommentare dazu stärkten in den meisten Fällen nur die eigene Klientel unter den Lesern. Das führt dazu, dass sich junge Journalisten dazu berufen sehen, die eigene Klientel vordringlich zu versorgen. Und nicht auch jene ins Boot der faktenbasierten Wirklichkeiten zurückzuholen, die aus diesem Boot in die schwankenden Raddampfer des Populismus umgestiegen sind.
Sie kritisierten vorher auch diese Selbstüberhöhung deutscher Medien …
… die aber auch Selbstgewissheit war. Als ich zum Beispiel für den Stern den fünfzigsten Geburtstag von Jörg Haider, dem immer noch bekanntesten aller Rechtspopulisten, fotografierte, da wollte Haider die anwesenden Journalisten und Fotografen in ihrem Auftreten kanalisieren. Ich habe nach Rücksprache mit der Hamburger Redaktion Haider die Möglichkeit zur Kenntnis gebracht, auch mit einem Hubschrauber anstatt mit der von der FPÖ bestimmten Jornalisten-Buskarawane an den Feierort, dem Gipfel der Gerlitzen nahe der Kärntner Stadt Villach, gebracht zu werden, weil die Redaktion im Notfall diesen Hubschrauber mit Pilot mieten würde. Haider hat mich danach anders behandelt und ich konnte weit intimere Fotos für den Stern schießen als alle anderen Kollegen.
Dieses Können und nicht nur Wollen, das war Wirkungsmacht. Und vielleicht übertrieben, obwohl es mir selbstredend gut gefiel, als Vertreter einer damals noch mächtigen deutschen Illustrierten aufzutreten. Klar aber auch: Wenn diese Postulate nicht mehr einer neuen wirtschaftlichen Basis entsprechen, dann ist es Glück und Freude der Mächtigen, diese Selbstgewissheit der Medien hämisch zu brechen. Und genau deswegen gibt es jetzt gerade auch so wenige ehrliche Fürsprecher klassischer Qualitätsmedien.
Moment: Die Medien sind nicht da, um Mächtigen zu gefallen.
Wie es ein US-Höchstrichter im Fall der Pentagon-Papers 1971 richtig formulierte, sind Medien dazu da, den Regierten zu dienen. Und nicht den Regierenden. Das überhöhende, ja sogar überbordende Wichtigtun deutscher Medien, wie ich es erlebte, hatte aber oft eine infantile Weste über, eine von Männern, von Kerlen, gestrickte Weste, die zu fast schon gleichgültigem Umgang mit Spesengeldern führte. Das alles gab es in anderen Ländern mit großen Medien viel seltener. Und das alles hat auch mit der damaligen mentalen Verfasstheit von Herausgebern, Chefredakteuren und auch Ressortleitern in Deutschland zu tun, die in Zeiten nach der Hitler-Tagebuch-Affäre des Stern immer noch große Macker sein wollten – obwohl die Glocke zur letzen Runde längst geschlagen war. Diese Rechnung, die auch nach Relotius neu ausgestellt wurde, bezahlen deutsche Qualitätsmedien bis heute.
Das ist ein guter Schluss. Wir danken für dieses Interview, das wir beide ja als zwei Personen in nur einem Körper geführt haben.
Aber ich denke, manchmal wäre es für Journalisten nicht schlecht, sich selbst zu interviewen.

Sehr schönes Gespräch!
danke dir!
Hervorragender Text.
Typofund: der “Affenfelsen”, das HAUTquartier des Stern …