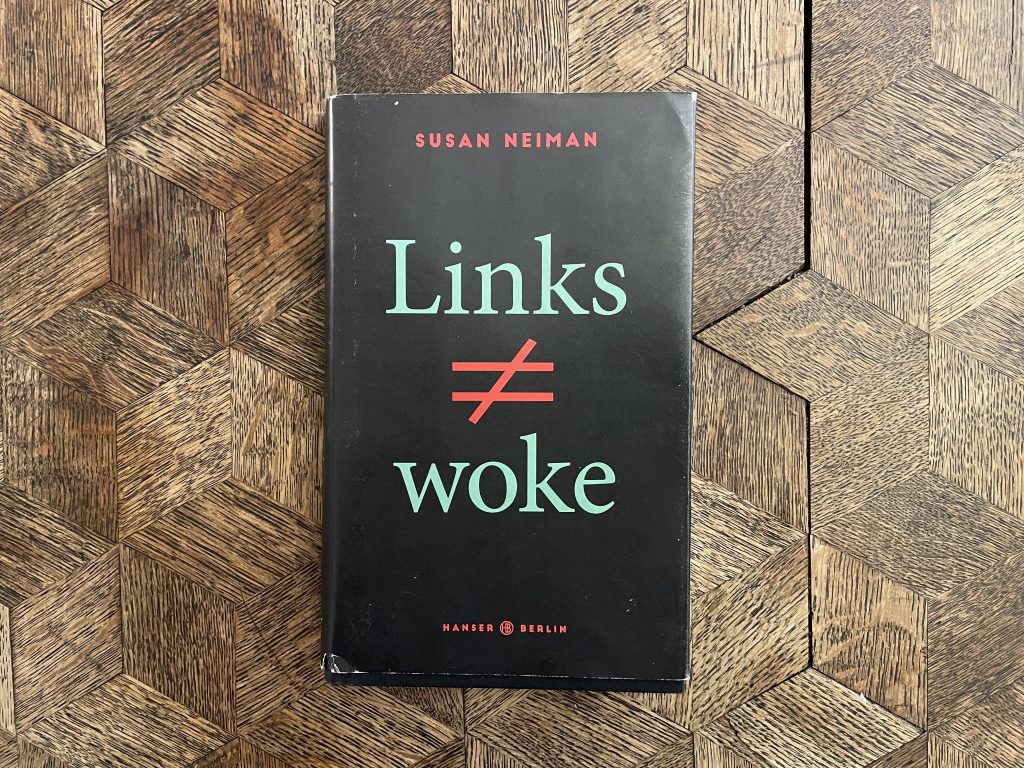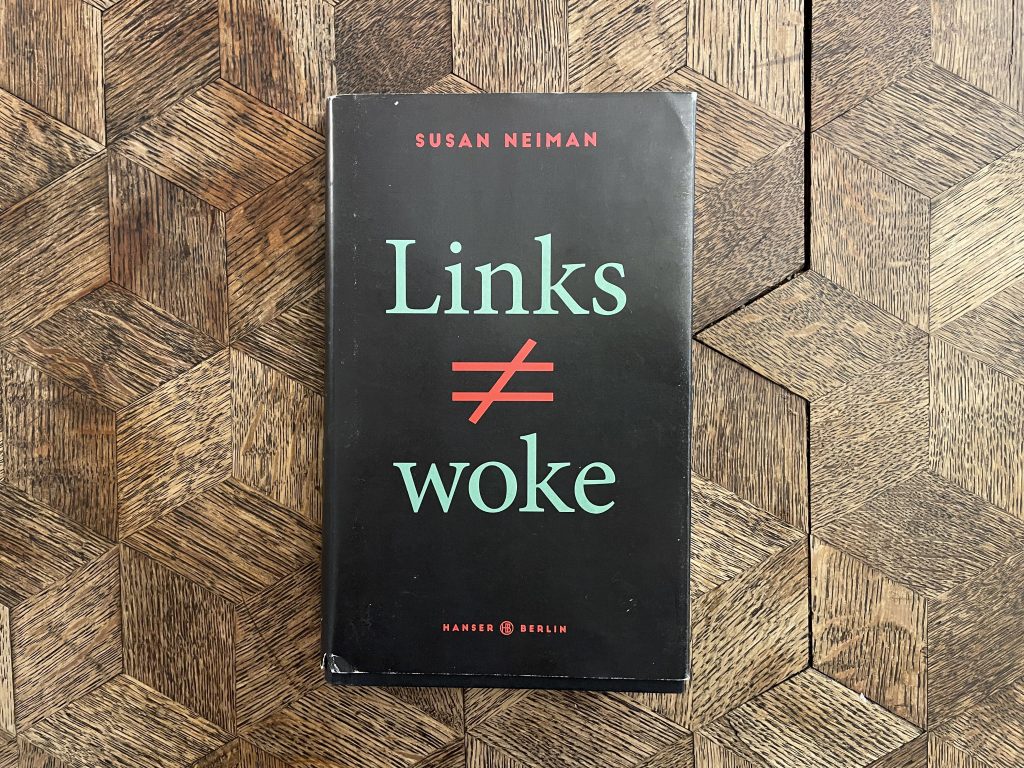
Von Geert Keil
Wenn die Linke nicht woke ist, was ist sie dann? In seiner Besprechung von Susan Neimans “Links ist nicht woke” (erstmals erschienen in FR online am 12.09.2023) argumentiert der Philosoph, Hochschullehrer und Autor Geert Keil, auch eine Orientierung an Gruppeninteressen, wie sie sich in großen Teilen der “nicht-woken” Linken finde, sei mit einem moralischen Universalismus unvereinbar. Wer sich an der Diskussion über die von Neiman aufgegriffenen Fragen über das Verhältnis von “woke” und “links” beteiligen will, kann dies demnächst auch live tun: Auf Einladung des ROTEN SALON kommt die US-Philosophin am 5. Februar nach Hamburg, um die Thesen ihrer international erfolgreichen Streitschrift zu diskutieren. M.H.
Nein, Woke ist nicht das neue Links, findet die Philosophin Susan Neiman. In ihrer um Zuspitzung nicht verlegenen Streitschrift hält sie der woken Bewegung vor, die universalistischen Ideale der Aufklärung preisgegeben zu haben und statt dessen aus trüben Quellen zu schöpfen: aus dem Freund-Feind-Denken Carl Schmitts und Foucaults diffuser Machtkritik, die Neiman für reaktionär hält.
Vom rechten Pfad der linken Tugenden seien die Woken an drei Stellen abgekommen: Den moralischen Universalismus hätten sie zugunsten von »Stammesdenken« aufgegeben, nämlich der Parteinahme für einzelne Opfergruppen. Sie reduzierten zweitens Gerechtigkeitsfragen auf Machtfragen und hätten sich drittens vom Glauben an die Möglichkeit des Fortschritts verabschiedet.
Neimans Buch ist in allen großen Feuilletons besprochen worden. Dabei zeichnet sich ein Muster der Kritik ab: Es wird nicht bestritten, dass es die genannten Tendenzen gibt. Bestritten wird, dass diese gemeinsam eine ominöse »woke Bewegung« ausmachen. Insbesondere wird Neiman ein Mangel an Belegen vorgehalten. Sie lasse die Kritisierten nicht zu Wort kommen, bleibe den Textnachweis der Verirrungen schuldig und werfe zu viel Unterschiedliches in einen Topf. Hilal Szegin und Novina Göhlsdorf sprechen von einem »Schattenboxen«. Wokeness werde nirgends zufriedenstellend definiert, die Kontaktschuld mit Carl Schmitt sei bloß herbeigeredet.
In diese Kerben möchte ich nicht mehr schlagen, sie sind nun tief genug. Susan Neiman war tatsächlich nicht gut beraten, die mit guten Gründen kritisierten Auffassungen – das Freund-Feind-Denken, den Tribalismus, die Fixierung auf Machtfragen – zu bündeln, als definierende Merkmale einer »woken Bewegung« auszugeben und dieser dann noch Einflüsterer anzudichten.
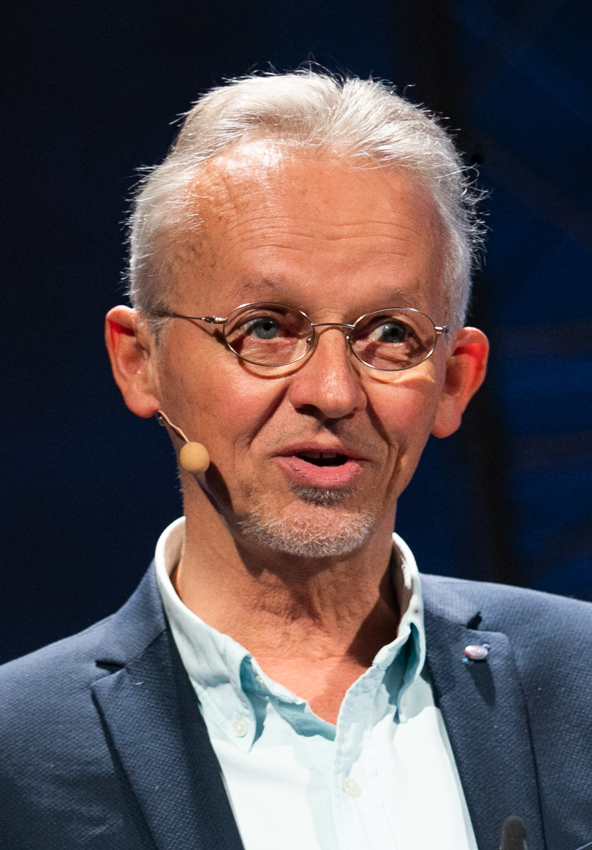
Mein Zwischenruf betrifft nicht Neimans Kritikziel, sondern ihr Gegenbild der wahren Linken. Wenn Woke nicht das neue Links ist, was ist denn der Kern des Linksseins, den Neiman so vehement gegen diejenigen verteidigt, die falsch abgebogen seien? Für Neiman ist die Sache klar: Dieser Kern sind eben die aufklärerischen Ideale, die ihr am Herzen liegen – Universalismus, Gerechtigkeit, Fortschritt. Ich wäre mir da nicht so sicher. Gehört insbesondere der moralische Universalismus wirklich zur DNA der politischen Linken?
Gibt es noch einen linken Markenkern?
Durch philosophische Begriffsanalyse wird man das nicht herausbekommen. »Links« ist eine historisch kontingente Bezeichnung, die auf die Sitzordnung im französischen Parlament ab 1830 zurückgeht. Halten wir uns zunächst an die politische Linke in Deutschland, wie sie in der gleichnamigen Partei, dem linken Flügel der Sozialdemokratie, der Gewerkschaften und der Sozialverbände institutionalisiert ist. Hier dürfte sich auch heute noch ein Markenkern ausmachen lassen. Er besteht in einer bestimmten Einstellung zu sozialer Ungleichheit. Links ist, die Verringerung ökonomischer Ungleichheit zu fordern, mehr staatliche Umverteilung und weniger Markt, gesellschaftliche Teilhabe statt bloß formaler Chancengleichheit. Was auch immer sonst noch zum Linkssein gehört, zentral ist das, was man in der politischen Philosophie eine egalitäre Orientierung nennt. Links ist etwa, eine kräftige Anhebung des Mindestlohns, eine Vermögenssteuer oder höhere Sozialleistungen zu befürworten.
Zum Linkssein gehört aber auch eine bestimmte Rangordnung politischer Ziele. Links ist es, den Abbau von Ungleichheit oder zumindest mehr soziale Sicherheit weit oben auf die Liste der politischen Prioritäten zu setzen. Deshalb gehört es zur politischen DNA der Linken – nun spreche ich von der gleichnamigen Partei –, politische Streitthemen wie das Heizungsgesetz oder Boykottmaßnahmen gegen Russland zunächst einmal darauf zu prüfen, ob ökonomische Belastungen für »die kleinen Leute« zu erwarten sind.
»Aber die Linke hat sich doch modernisiert!«
Nun hat sich die Linke kulturell modernisiert und scheint nicht mehr allein auf Verteilungsfragen fixiert zu sein. Führt sie nicht heute viel häufiger Anerkennung und Gerechtigkeit im Munde statt ökonomischer Gleichheit? Und hierhin gehört die Wokeness im Sinne einer gesteigerten Sensibilität für Ungerechtigkeit gegenüber Angehörigen marginalisierter Gruppen.
Susan Neiman ist nicht die erste, die hier einen Konflikt sieht. Nancy Fraser, Bernd Stegemann und andere haben den progressiven Mainstream der »kulturalistischen Linken« dafür kritisiert, dass er sich von ökonomischen Kämpfen auf kulturelle verlegt habe: Die Klassenfrage veraltet, LGBTQ+ kommt, der Kapitalismus bleibt.
Es ist allerdings nicht zu sehen, warum Sensibilität für gruppenbezogene Benachteiligung der egalitären Agenda der klassischen Linken widersprechen sollte. Es geht der kulturalistischen Linken nicht allein um symbolische Anerkennung, sondern um Rechte. Sie könnte der Kritik entgegenhalten, dass es einen beträchtlichen Überschneidungsbereich zwischen einer verteilungspolitischen Agenda und dem Einsatz für die Rechte marginalisierter Gruppen gebe. Wo soll hier der Konflikt sein? Woke sei vielleicht nicht das neue Links, aber doch ein wichtiger Teil davon.
Langsam. Eine Überschneidung in dem Sinne, dass viele sich als links identifizierende Personen und Milieus einen großen Teil der genannten Auffassungen teilen, gibt es sicherlich: für Minderheitenrechte, Anerkennung, Diversität, aber auch für soziale Sicherheit und egalitärere Verteilung. Nun steht aber gerade in Frage, was ein solches Bündel von Auffassungen »links« macht. Wodurch wird es zusammengehalten? Die Frage nach dem linken Markenkern ist keine soziologische, Neiman hält das linke Selbstverständnis der woken Bewegung für ein Selbstmissverständnis. Diese Kritik entkräftet man nicht durch Bekräftigung einer Selbstzuordnung.
Seine kritischen Maßstäbe ausweisen
Im Mai 1802 äußerte sich Napoleon im Staatsrat zum Sklavenaufstand auf Saint-Domingue: »Ich bin für die Weißen, weil ich weiß bin. Ich habe keinen anderen Grund, und der ist der beste.« Was für Napoleon der beste Grund war, war ein erbärmlich schlechter. Aber warum war er schlecht? Weil die Weißen in diesem Fall die französischen Kolonisatoren waren? Oder nicht doch eher, weil koloniale Versklavung menschenrechtswidrig und moralisch nicht zu verteidigen ist? Wäre Versklavung moralisch besser, wenn Toussaint Louverture sie als Schwarzer unterstützt hätte? Wenn er moralisch so korrupt gewesen wäre wie Napoleon?
Aus Sicht des politischen Aktivismus mag das eine akademische oder sogar frivole Frage sein. Politische Bewegungen beruhen auf einem Zusammenschluss mit Gleichgesinnten, die durch Überzeugungen oder Interessen zusammengehalten werden. Die jeweiligen politischen Ziele erscheinen dann als normative Selbstläufer: Selbstredend muss Raubkunst zurückgegeben, Geschlechtsangleichung erleichtert, der Kapitalismus überwunden werden. Außerhalb von Blasen Gleichgesinnter ist es nicht so einfach. Spätestens beim Versuch, demokratische Mehrheiten zu gewinnen, muss man Gründe dafür liefern, dass etwas moralisch richtig oder falsch, geboten oder unakzeptabel ist. Von dieser Zumutung bleibt auch nicht verschont, wer das Herz auf dem linken Fleck hat oder zu haben glaubt. Habermas hat das in einer auf Adorno gemünzten Bemerkung so ausgedrückt, dass eine kritische Gesellschaftstheorie in der Lage sein müsse, die Maßstäbe ihrer Kritik auszuweisen.
Die Kritische Theorie ist ein gutes Beispiel für diese Herausforderung, verknüpft sie doch ihre Theoriearbeit mit einer emanzipatorischen, also politischen Agenda. Es gehört bis heute nicht zu ihren Stärken, normativ zu begründen, warum bestimmte Ziele geboten sind. Die Kritische Theorie ist nicht sonderlich gut in normativer Ethik und findet das auch gut so. Wenn man sich akademisch und politisch vornehmlich mit Gleichgesinnten umgibt, fällt dieses Defizit auch nicht so auf.
Erst kommt das Interesse, dann die Moral
Neiman betrachtet die Linke durch die rosarote Brille ihres aufklärerischen moralischen Universalismus kantischer Prägung. Tatsächlich spielt für die klassische Linke das Interesse eine ungleich größere Rolle als die Moral. Interessen sind aber ihrer Natur nach partikular. Sie gründen nicht darauf, dass etwas moralisch richtig wäre, sondern darauf, dass jemand oder eine Gruppe etwas will. In Reinform sieht man das in Tarifkonflikten: Die Arbeitnehmerseite hat ein Interesse daran, einen größeren Teil vom Unternehmensgewinn abzubekommen. Die Arbeitgeber wollen den Gewinn für sich selbst, für die Aktionäre oder für künftige Investitionen. Beide Seiten verstehen sich darauf, ihr Interesse als Gemeinwohl auszugeben, aber im Kern bleibt es ein Interessenkonflikt – ein Verteilungskampf, der durch die Verhandlungsposition oder die besseren Nerven entschieden wird.
Ein deprimierendes Beispiel für die moralisch vergiftende Kraft interessebasierten Denkens bietet die Debatte über »weiße Privilegien« und »weiße Ignoranz«. So geht der Philosoph Charles W. Mills von der bedenkenswerten Einsicht aus, dass marginalisierte Gruppen in der Regel ein Interesse daran haben, die soziale Welt zu verstehen, etwa um gefährliche Situationen zu meiden. Privilegierte, die weniger Gefahren ausgesetzt sind, hätten dieses Interesse nicht. So weit, so gut. Mills behauptet dann aber weiter, Weiße besäßen ein aktives »weißes Gruppeninteresse« daran, die soziale Welt verzerrt wahrzunehmen, weil sie schließlich von bestehender rassistischer Diskriminierung profitierten.
Das ist eine komplett deprimierende Sichtweise – moralisch, politisch und philosophisch. Warum um alles in der Welt sollten nicht von rassistischer Diskriminierung Betroffene ein aktives Interesse daran haben, dass der Rassismus fortbesteht? In der Rahmung von Privilegien und Interessen erscheint tatsächlich jeder Fortschritt als Nullsummenspiel: Was die einen gewinnen, müssen die anderen abgeben. Emanzipatorisches Handeln erscheint dann als parteiischer Machtkampf. Auch der Ausgang ist dann schlicht eine Machtfrage, die Stärkeren gewinnen. Nun ist aber die Anerkennung und Durchsetzung von Rechten als Interessenkonflikt fehlbeschrieben. Die Gewährung gleicher Rechte ist gerade kein Nullsummenspiel, sondern eine Win-Win-Situation. Warum sollte es im Gruppeninteresse der Weißen liegen, dass Schwarze häufig von Polizeigewalt betroffen sind? Es ist auch kein »Privileg«, nicht von der Polizei verprügelt oder erschossen zu werden, sondern schlicht ein Recht.
Man sieht an diesem Beispiel, wie vergiftend es sein kann, die Verweigerung moralischer und politischer Rechte in Form von gruppenspezifischen Privilegien zu beschreiben. Die amerikanische Bürgerrechtsbewegung wusste es besser. Wie es in einem Song über die Ermordung des schwarzen Bürgerrechtlers Medgar Evers heißt, den Neiman zitiert: »All men are slaves till their brothers are free«.
Moralischer Universalismus ist unersetzlich
Der moralische Universalismus, der allen Menschen ungeachtet ihrer Gruppenzugehörigkeit dieselben Grundrechte zubilligt, hat sich in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte niedergeschlagen. Auch diese Erklärung weist ihren kritischen Maßstab nicht aus, sondern setzt ihn voraus; der Text ist keine philosophische Abhandlung. Die Begründung des moralischen Universalismus ist eine Aufgabe für die normative Ethik. Kant hat mit seiner Herleitung des kategorischen Imperativs einen ziemlich guten Vorschlag gemacht, aber auch die meisten anderen Ethiken der philosophischen Tradition sind universalistisch – auch außerhalb von Europa: Neiman beklagt mit Recht, dass Philosophen aus dem globalen Süden selektiv zugehört wird. Schwarze Denker wie Ato Sekyi-Otu, die einen »linken Universalismus« verteidigen, passen nicht in den Mainstream dekolonialistischer Theoriebildung.
Der moralische Universalismus ist auch strategisch überlegen, wenn Ansprüche aufeinandertreffen. Neiman illustriert diese Überlegenheit mit einer einfachen Frage: »Betrachtet man die Forderungen von Minderheiten nicht als Menschenrechte, sondern als Rechte einer bestimmten Gruppe, was hindert dann die Mehrheit daran, auf ihren eigenen zu bestehen?« (35). Im Interessenkonfliktsmodell hindert sie nichts daran. Und die klassische politische Linke argumentiert nun einmal – wie Mills – interessenbasiert statt moralisch: Es ist doch nur erwartbar, dass die Überprivilegierten von sich aus nichts abgeben wollen, das wäre gegen ihr Interesse. Deshalb müssen die Unterprivilegierten sich organisieren, stärker werden, ihre eigenen Interessen im Kampf durchsetzen. Marx, Engels und Lenin setzten auf den revolutionären Klassenkampf, Dutschke und die Sozialdemokratie auf den Marsch durch die Institutionen, Gewerkschaften auf den Arbeitskampf. Kulturalistisch-identitäre Linke setzen auf das Erlangen kultureller Hegemonie, zumindest in den maßgeblichen Milieus.

Ort: Universität Hamburg, Von-Melle-Park 9 (FB Sozialökonomie, ex HWP), EG, Großer Hörsaal
»Aber gleiche Rechte mussten doch erkämpft werden!«
Bürgerliche Linksliberale wie Rawls und Habermas, die auf den Diskurs, die Vernunft und das Recht setzen, müssen sich von kämpferischen Linken oft daran erinnern lassen, dass gleiche Menschen- und Bürgerrechte historisch erstritten werden mussten und dass dieser Kampf ein linker gewesen sei. Richtig, es bedurfte und bedarf manchmal des Drucks der Straße oder des zivilen Widerstands, um gesellschaftliche Veränderungen in Gang zu setzen. In autoritären Staaten, die politische Betätigung verfolgen, kann dazu auch Waffengewalt gehören.
Hier stand indes zur Debatte, worin die DNA des Linksseins besteht. Dazu können der Druck der Straße oder der bewaffnete Kampf schon deshalb nicht gehören, weil nichtfriedliche Mittel als Ultima ratio auf beiden Seiten des politischen Spektrums vorkommen. Spezifisch links wären erst Merkmale, die linke Militanz von rechter unterscheiden.
Wer in einem demokratischen Staat Gruppenrechte einfordert, braucht etwas, an das er appellieren kann. Der moralische Universalismus der Aufklärung ist ein solcher Standard, den man beim Wort nehmen kann. Dasselbe gilt für den Grundrechtskatalog unserer Verfassung. Hingegen liefert der Verweis auf ein Interesse keinen solchen Maßstab. Übrigens auch nicht die Existenz von Leid: Manches Leid ist unvermeidlich, manchmal ist die Vermeidung nur auf Kosten größerer anderer Übel möglich, es gibt deshalb keinen kategorischen Imperativ der Leidvermeidung.
Universalismus als Deckmantel?
Das stärkste Kapitel von Neimans Buch ist das zweite, in dem sie die europäische Aufklärung gegen den um sich greifenden Vorwurf verteidigt, der Universalismus habe bloß die partikularen Interessen Europas verschleiert, mit Kolonialismus und Rassismus aber keine Probleme gehabt. Dieses postkolonialistische Narrativ sei nur schwach von Textkenntnis getrübt. Rousseau, Diderot, Lahontan und Kant gehörten zu den ersten, die den Eurozentrismus und den Kolonialismus verurteilten. Die koloniale Gewaltherrschaft hatte keinerlei Recht, sich auf aufklärerische Ideen zu berufen. An diesem Befund würde sich übrigens auch nichts ändern, wenn es dem Hobbyanthropologen Kant in seinem Alterswerk nicht mehr gelungen wäre, seine krude Rassenlehre als moralisch irrelevant zu erkennen.
Der moralische Universalismus meint mit »alle Menschen« tatsächlich alle, ungeachtet ihrer Herkunft, sozialen Stellung, Religion, sexuellen Orientierung. Daran gibt es in normativer Hinsicht nichts zurückzunehmen. Spätere Errungenschaften wie die Abschaffung der Sklaverei, die Einführung des Frauenwahlrechts oder die Entkriminalisierung der Homosexualität versteht man am besten als Konkretisierungen des Gleichberechtigungspostulats der Aufklärung. Vielleicht auch als Erinnerung für die Begriffsstutzigen: Ja, »alle« bedeutet »alle«.
Gleichwohl wird ernsthaft vertreten, dass der aufklärerische Universalismus bloß partikulare Interessen weißer europäischer Männer verschleiere. Wer tatsächlich der Auffassung ist, dass den Universalismus beim Wort zu nehmen den partikularen Charakter des politischen Kampfes verkenne, möge sich diese bittere Wahrheit vor Augen führen: Sobald die Adressaten einer partikularen Forderung die Behauptung, dass die Durchsetzung eine Machtfrage sei, ihrerseits beim Wort nehmen, steht der Fordernde mit leeren Händen da. Eine um Gruppeninteressen gescharte kulturalistische Linke, die auf Tribalismus setzen wollte – Neimans Ausdruck, nicht meiner –, ist für politisch rauere Zeiten denkbar schlecht gerüstet. Sie hat beispielsweise gegen die unheimliche Erfolgssträhne des neuen Rechtspopulismus, wie Michael Hampe einmal gesagt hat, »außer ihrer partikularen politischen Meinung nichts, aber auch gar nichts in der Hand«.
Nun verteidigt Neiman gerade die Autonomie von Gerechtigkeitsfragen gegenüber Machtfragen. Sie wirft denjenigen, die sich von Carl Schmitt und Foucault den Kopf haben verdrehen lassen, vor, diese Unterscheidung aufgegeben zu haben. Mein Dissens mit Neiman betrifft ihre Annahme, dass die wahre Linke in dieser Hinsicht besser abschneide. Neiman identifiziert das Linkssein mit dem moralischen Universalismus der Aufklärungsphilosophie. Diese Darstellung ist eher von Wunschdenken getrieben als durch Belege gestützt. Tatsächlich sitzt die Linke im Glashaus, wenn sie den als woke Apostrophierten die Preisgabe aufklärerischer Ideale vorhält.
Die als woke Apostrophierten führen immerhin die Gerechtigkeit im Munde und sind damit zumindest verbal moralaffiner als die klassische, interessenorientierte Linke. Beide stehen gleichermaßen vor der Herausforderung, mit eigenen Mitteln ihre normativen Maßstäbe zu begründen, nachdem sie den Universalismus diskreditiert haben. Ob es einmal gelingen wird, die Forderung »Gerechtigkeit für X« überzeugend auf eine Weise auszubuchstabieren, die sich nicht auf den moralischen Universalismus stützt, bleibt abzuwarten. Bislang hat es niemand hinbekommen.
Warum überhaupt Bündel schnüren?
Für Neiman war die Versuchung, die Frage nach dem Kern des Linksseins mit dem Markieren der eigenen politischen Überzeugungen zu verknüpfen, offenbar zu groß. Politiker:innen dürfen dieser Versuchung erliegen, Intellektuelle sollten es besser nicht tun. Neiman wirft nicht nur bei ihrem Kritikziel, sondern auch bei der Charakterisierung des Linksseins zu viel in einen Topf. Diejenige Art von aufklärerischer Vernunftmoral, die ihr vorschwebt – kosmopolitisch, universalistisch, kantianisch, rechte- und pflichten- statt interessenbasiert, der Res Publica verpflichtet – lässt sich nur mit großen Verrenkungen mit der wahren Linken identifizieren. Politisch heimatlos ist dieses Bündel nicht, es gibt ja noch Robert Habeck.
Hätte Neiman sich mehr Mühe mit dem Nachweis geben sollen, dass eben dieses Bündel die wahre Linke ausmache? Ich denke nicht und möchte ein anderes Fazit ziehen: Wer nicht gerade Parteiprogramme schreiben muss, könnte einfach damit aufhören, politische Auffassungen zu Bündeln zu schnüren und diese mit »links«, »rechts«, »liberal«, »woke« oder »konservativ« zu beschriften. Die zeitdiagnostische Kraft dieser Etiketten nimmt mit der Größe der Bündel ab. Das Schnüren großer Bündel ist kein Aufklärungsfortschritt und behindert konstruktive politische Debatten. Auch Neimans Verteidigung der aufklärerischen Ideale wäre nicht schwächer ausgefallen, wenn sie auf den – aus Marketinggründen ersonnenen? – Titel des Buches verzichtet hätte.
Susan Neiman, Links ist nicht woke, Hanser Berlin, 176 Seiten, 2023, 22 €