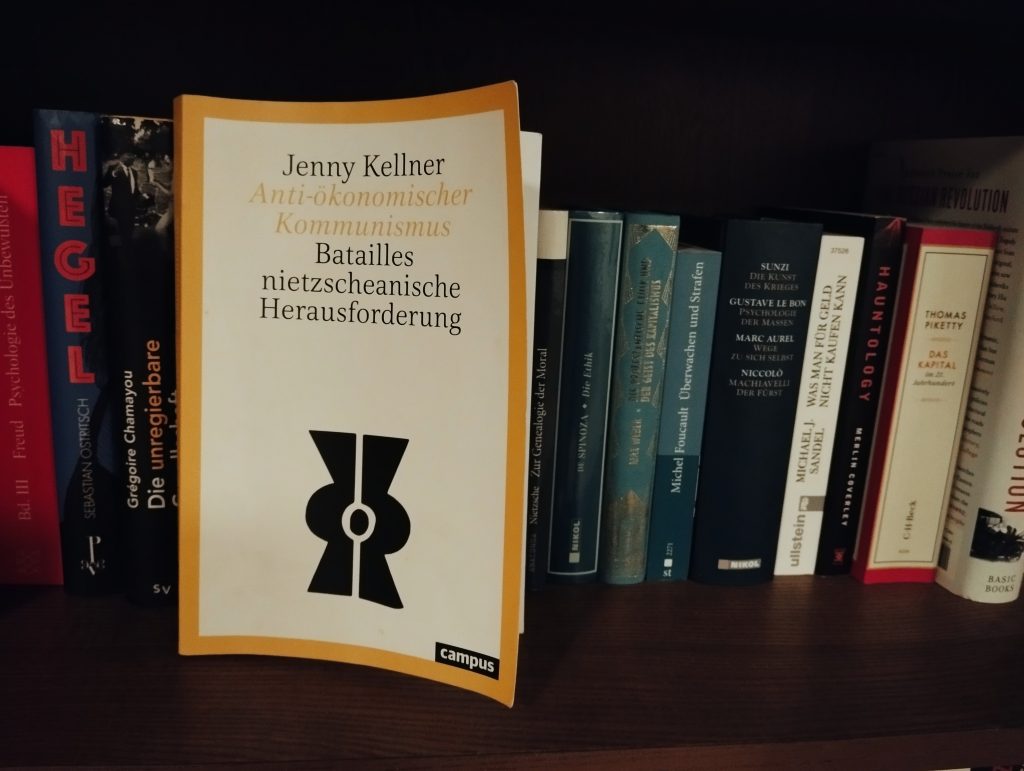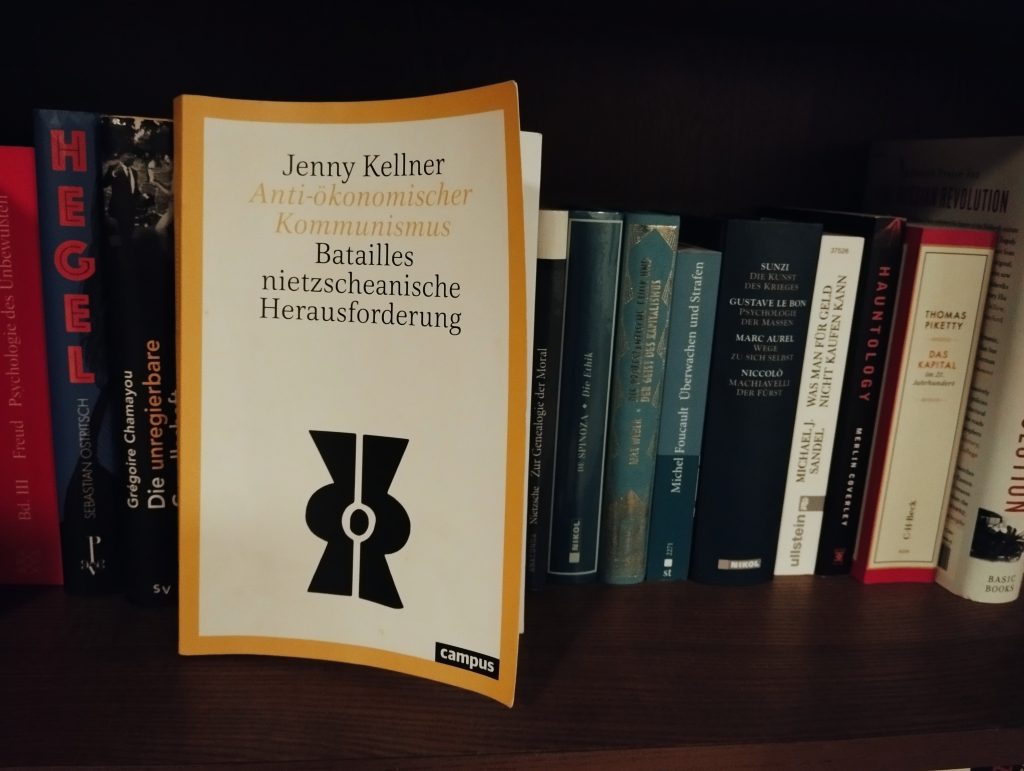
In letzter Zeit war viel vom Kommunismus die Rede in diesem Blog, auf der Website und den Veranstaltungen des ROTEN SALON HAMBURG. Warum? Lasst es mich mal so begründen: In einer Zeit, in der Alternativen zum Kapitalismus, so überlebensnotwendig sie sich gerade auch darstellen, verschüttet scheinen, nicht greifbar, die Vorstellung überfordernd, könnte es hilfreich sein, nochmal zu gucken, was denn mit dem Kommunismus gemeint war (der „Ostblock“ kann es ja nicht gewesen sein) und was man ihm heute noch abgewinnen könnte.
Kommunismus meint im Kern, Vergesellschaftung der Produktionsmittel, und das ist ja nicht etwas, das man heute nicht aussprechen darf. Selbst Wirtschattsberater geben Workshops dazu.
Kommunismus meint ja nichts anderes, als mehr Gleichheit – auch das eine Forderung, die heute mehr als geläufig ist. Wir sprechen also nicht von Kinderschändung. Es es muss auch nicht jeder sein Handy abgeben.
Es ist veständlich, das vielen der Begriff „Kommunismus“ als verbrannt erscheint. Nur, wenn der Rauch verzogen ist, was haben wir da? Ist der Kommunismus als Maximalvorstellung, nicht nach wie vor der Orientierungspunkt, in gewisser Weise auch der Ursprung, wenn wir vom „Sozialen“ sprechen? Hätte es, ohne marxistischer Vorgeschichte, je einen Klassenkampf gegeben, der mit Erfolgen in der Umverteilung die Lage der Arbeiterklasse verbessert hat, man könnte sagen, sosehr, dass sie sich heute gar nicht mehr als Arbeiterklasse fühlt?
Wenn wir den Kommunismus verlieren, verlieren wir dann nicht alles, was uns zu sozialen, mitfühlenden Wesen macht, der Solidarität fähig?
Nennt es Sozialismus, das ist okay für mich, aber Sozialismus ist schon ein Begriff, der zur Metamorphose mit dem Kapitalismus hinleitet, wie er mit der Sozialdemokratie vollendet wurde. Ich komme aus einem Land, in dem eine sozialistische Partei, zur „sozialdemokratischen“ umbenannt wurde, mit Folgen. Lest heute im Blog Finn Schreibers Besprechung von Jenny Kellners „Anti-Ökonomischer Kommunismus“, das in seiner philosophischen Dichte einen wunderbaren Anreiz bietet, mal ein bisschen anders über die ganz grossen Fragen nachzudenken.
In Kellners Buch geht es allerdings weniger um den „sozialen“ Kommunismus, sondern um den Kommunismus als Metapher für das Gegenteil, als Praxis des »Anti« als Ausdruck der »Anfechtung« selbst besteht: im Widerstand gegen Verwertung, Funktionalisierung und politische Totalisierung. Auch dagegen kann man schwerlich sein. M.H.
![kellnerjenny c tillmann engel 4c[1]](https://michael-hopp-texte.de/wp-content/uploads/2025/10/KellnerJenny_c_Tillmann_Engel_4c1-709x1024.jpg)
Was ist der anti-ökonomische Kommunismus?
Von Finn Schreiber
Manch einer mag den Begriff für überholt halten. Viele assoziieren mit ihm die gescheiterten realsozialistischen Staaten des vergangenen Jahrhunderts und denken an Armut, Gewalt und fehlende Freiheiten. Doch muss man nicht wissen, worauf man schießen möchte, wenn man einen Bogen spannt? Muss man für eine in der Gegenwart verwurzelte Kritik unserer Gesellschaft nicht wissen, woran man diese eigentlich blamieren möchte? Umso begrüßenswerter, dass Jenny Kellner mit ihrem neuen Buch »Anti-ökonomischer Kommunismus – Batailles nietzscheanische Herausforderung« ein Plädoyer dafür gibt, den Kommunismus neu zu denken.
Dabei bringt sie in der Auseinandersetzung und Systematisierung des Werkes des französischen Philosophen Georges Bataille (1897-1962) zwei Denker zusammen, die auf den ersten Blick verschiedener nicht sein könnten: Karl Marx (1818-1883) und Friedrich Nietzsche (1844-1900).
Dass Marx etwas mit dem Kommunismus zu tun haben sollte, leuchtet natürlich ein, doch bei Nietzsche müssen die meisten eingefleischten Kommunisten und Marxisten dann doch schlucken.
Eine Nietzsche-Lektüre von links scheint in Deutschland nämlich eher ein Schattendasein zu fristen, wenngleich es in Frankreich eine lange Tradition gibt das radikal-emanzipatorische Potential bei Nietzsche freizulegen (unter anderem Gilles Deleuze, Michel Foucault und Roland Barthes). Ein wichtiger Grund dafür ist sicherlich Bataille selbst und seine Beschäftigung mit Nietzsche. Batailles Werk hat die Philosophie in Frankreich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts maßgeblich beeinflusst hat.
Jenny Kellners Werk ist die überarbeitete Fassung ihrer Dissertation. Es stellt den systematischen Versuch dar, Georges Batailles Philosophie, insbesondere seine Rezeption Friedrich Nietzsches, für eine politisch interessierte philosophische Begriffsarbeit fruchtbar zu machen. Im Zentrum der Auseinandersetzung steht dabei der Begriff des »anti-ökonomischen Kommunismus«.
Die Aufgabe ihres Buches sieht Kellner dabei in dem Neudenken der Idee des Kommunismus:
»Wenn der Traum vom Kommunismus und sein historisches Desaster heute
in eine unauflösliche Zerrissenheit versetzen, so muss der Kommunismus
in dieser Zerrissenheit neu gedacht werden. Diese Aufgabe lässt sich mit der
nietzscheanischen Herausforderung Batailles verbinden. Denn das Verhältnis
zwischen Nietzsche und dem Kommunismus stellt sich, Bataille zufolge, wie das
Verhältnis zwischen zwei Fremden dar, die einander zu erkennen nicht imstande
sind und doch zutiefst aufeinander angewiesen zu sein scheinen, um die Frage
nach einer befreiten Menschheit voll zu entwickeln.« (S. 8)
Der antifaschistische Nietzsche!?
In einem ersten Schritt analysiert Kellner, wie Bataille sich die Theorie Nietzsches aneignet, um diesen gegen die Vereinnahmung durch faschistische Strömungen zu verteidigen. Dabei zeigt sie, dass Bataille Nietzsches Denken nicht als bloße Herrschaftsphilosophie liest, sondern als Theorie der Differenz und des Exzesses. Kellner rekonstruiert, wie Bataille Gewalt, Mythos und Gemeinschaft beim Faschismus untersucht und zu dem Schluss kommt, dass Faschismus sich gerade durch seine Unterdrückung des Heterogenen und Exzessiven auszeichnet.
Zentraler theoretischer Anknüpfungspunkt ist dabei Batailles Text »Die psychologische Struktur des Faschismus« (1933). In dieser Arbeit führt Bataille das für ihn zentrale Begriffspaar Homogenität (die Sphäre der Produktion, Rationalität und Nützlichkeit) und Heterogenität (die Sphäre des Exkrementellen, des Luxus und der Affekte) ein. Der Faschismus wird dabei als Verschmelzung von homogenen und heterogenen Elementen analysiert. Die unterdrückten heterogenen Kräfte, die in der homogenen Gesellschaft verleugnet werden, kommen demnach in katastrophischen Formen zum Ausdruck.
Dies erinnert an die Faschismustheorie des sogenannten Freudomarxismus von Wilhelm Reich, was kein Zufall ist, schließlich entstanden Batailles und Reichs Faschismusanalyse beide 1933 in der Auseinandersetzung mit der freudschen Psychoanalyse und Massenpsychologie.
Die irrationale Gemeinschaft
Das zweite Kapitel ist der Frage nach dem Begriff der Gemeinschaft gewidmet. Kellners Ausgangspunkte sind dabei, einerseits die »spätkapitalistischen Gesellschaften«, welche radikal vereinzelte und atomisierte Individuen hervorbringen. Andererseits die Herausforderung einer kommunistischen Gemeinschaft, dass diese einen totalen Anspruch auf die Inklusion aller Singularitäten erhebt, wobei dabei der Verlust der Individualität und das unkritische Auf- und Untergehen in der Gemeinschaft droht. Nach Kellner soll »rationales, intentionales, kritisch reflektiertes Handeln allein […] niemals zu einer tatsächlich kommunistischen Gemeinschaftsbildung führen [können]« (S. 101). Über dieses Problem soll der Gemeinschaftsbegriff von Bataille hinweghelfen.
Nach Kellner denkt Bataille dabei eine Form von Gemeinschaft, die nicht auf Zweckrationalität oder politische Institutionalisierung abzielt. Stattdessen steht bei ihm die Erfahrung der Ekstase, der Grenzüberschreitung und des Verlusts des Subjekts im Zentrum.
Batailles Konzept der Gemeinschaft soll dabei über die innere Erfahrung erschlossen werden, die als Gegenteil des Handelns und Aufkündigung der Ruhe definiert ist. Die innere Erfahrung ist eine Gemeinschaft derer, die keine Gemeinschaft haben, erreicht durch Kommunikation als Verlust der Identität und Dramatisierung der Existenz. Diese Dramatisierung funktioniert für Bataille dabei als »Anfechtung«, also als kontinuierliche Infragestellung alles Gegebenen. Dabei geht der Einzelne allerdings nicht in der Gemeinschaft vollends auf, sondern die Gemeinschaft stellt als »Ganzheit« eine nicht-identifizierbare Menge an Vielheiten dar. Diese radikale Haltung sei dabei anti-ökonomisch, da sie jegliches zweckrationales Handeln verneint und sich gleichzeitig von linken und rechten Identitätspolitiken abgrenzt.
Die Souveränität des anti-ökonomischen Kommunismus
Im abschließenden Kapitel entwickelt Kellner schließlich vollends die Figur des »anti-ökonomischen Kommunismus«. Ausgangspunkt ist Batailles Theorie der Souveränität, die eine Loslösung von Nützlichkeit und Zweck darstellt. Bataille denkt Souveränität dabei nicht als juristische Kategorie staatlicher Herrschaft, sondern als schwer greifbares und nie vollendetes Potenzial des Subjekts, den nützlichen und vernünftigen Menschen infrage zu stellen, die der Produktivität geltenden Verbote zu überschreiten und sich im Sinne einer anti-ökonomischen Revolte gegen die alles ökonomisierende Wirklichkeit zu stellen. Das Fehlen dieser Art der Souveränität wirft Bataille auch dem kommunistischen Projekt vor. Ein anti-ökonomischer Kommunismus hat laut Bataille vielmehr die Begriffe der Heterogenität, Gemeinschaft und Souveränität in seinem Sinne zu berücksichtigen und zu verwirklichen.
Kommunismus wird hier nicht als ökonomische Organisationsform, sondern als Bewegung der Verschwendung, des Exzesses und der Anfechtung begriffen. Kellner beschreibt, dass sich dieser Kommunismus nicht durch eine historische Utopie legitimiert, sondern in der Praxis des »Anti« als Ausdruck der »Anfechtung« selbst besteht: im Widerstand gegen Verwertung, Funktionalisierung und politische Totalisierung. Damit markiert sie eine radikale Alternative zu ökonomistischen oder rein programmatischen linken Ansätzen.
Der Kommunismus in weiter Ferne
»Es ist für Bataille kein Mensch denkbar, der nicht durc
den Widerspruch zwischen Verbot und Überschreitung, zwischen Rationalität
und Souveränität, zwischen Ökonomie und Anti-Ökonomie zerrissen wäre, und
gerade in dieser Zerrissenheit, dieser Spannung, dieser Paradoxie, sind alle
Menschen eins, bildet die Menschheit eine Gemeinschaft.« (S. 241)
Jenny Kellner ist mit ihrem Buch eine überzeugende und systematische Entwicklung des »anti-ökonomischen Kommunismus« bei Bataille gelungen. Dabei meistert sie den Spagat, das doch schwer zu überblickende, mystische und von zahlreichen Unzulänglichkeiten geprägte Werk Batailles auch für Nicht-Bataille-Kenner aufzubereiten, ohne dabei die produktiven Spannung und die bataillschen Eigenheiten mit der akademischen Dampfwalze einebnen. Auch als Inspiration für einen Einstieg in die linke Nietzsche-Lektüre eignet sich das Werk durchaus.
Manchmal wird man vom Wechselspiel aus Batailles Theoriebildung und Nietzsches Theorierezeption erschlagen und fragt sich, wo Bataille anfängt, Nietzsche aufhört und Jenny Kellner beginnt. Da der »anti-ökonomische Kommunismus« für Kellner allerdings ein paradoxes politisches Projekt voller Spannung ist, mag dies die Herausforderung sein, die Kellner den Lesern stellt.
Nichtsdestotrotz bietet der „anti-ökonomische Kommunismus” von Jenny Kellner einen unorthodoxen Zugang zum Begriff des Kommunismus und zeigt, dass es sich durchaus lohnen kann, an diesem Begriff festzuhalten. Auch wenn dies bedeutet, sich wirklich einmal zu fragen, was damit überhaupt gemeint sein könnte.
Jenny Kellner, Anti-ökonomischer Kommunismus -Batailles nietzscheanische Herausforderung, campus Verlag Frankfurt/New York 2025, 267 Seiten, 39,00 €