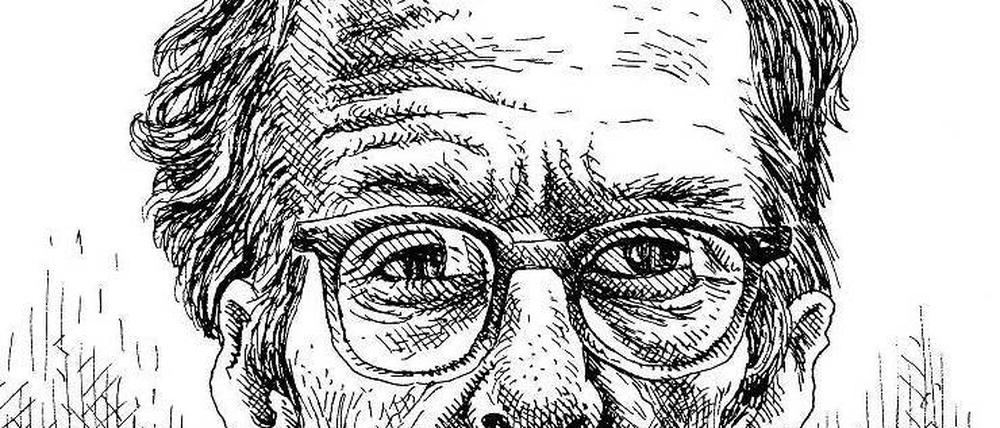Was hält das Kommunistische Manifest von Karl Marx und Friedrich Engels heute noch für uns bereit? Für die einen ist es ein überholtes Relikt, für andere ein literarisches Meisterwerk, ein Kampfruf, eine Diagnose des Kapitalismus oder gar eine Prophezeiung. Marx und Engels selbst betrachteten es früh als »geschichtliches Dokument« und doch wird es bis heute als Spiegel unserer Gegenwart gelesen, diskutiert, kritisiert und neu interpretiert. Zwischen Pathos und Polemik, zwischen wissenschaftlicher Analyse und poetischer Verdichtung entfaltet das Manifest jene eigentümliche Kraft, die ihm über 175 Jahre hinweg immer wieder Aktualität verleiht.
Dass es nicht bloß eine historische Fußnote geblieben ist, sondern nach wie vor Fragen aufwirft, Hoffnungen weckt und Widerspruch provoziert, zeigt sich in den Stimmen von Philosophen, Historikern, Politikerinnen und Künstlern gleichermaßen. Und so gilt: Wer dem Manifest zuhört, hört immer auch den Widerhall seiner eigenen Zeit.
Es folgt ein Überblick in Zitaten, aus der über 175 Jahren langen Werkgeschichte des Manifests
Redaktion: Finn Schreiber
»In Zeiten, da selbst Parteiführer der Linken ihren Anhängern prüfend mit der Frage entgegentreten, ob sie denn auch in der bürgerlichen Gesellschaft angekommen seien (und nicht etwa, ob sie wissen, wie man da wieder herauskommt!), scheint das Kommunistische Manifest ein von Gott sowieso, aber auch den Menschen verlassener Text zu sein. Er ist es nicht. Auch wenn, wie alles andere, so auch Texte ihre Zeit haben, und das Kommunistische Manifest natürlicherweise nunmehr Veraltetes an Aussagen genug enthält, gehört es doch zu jenen Dokumenten der Menschheitsgeschichte von nicht nur musealer Bedeutung. Seine Glocken hängen hinten, viele von ihnen läuten aber noch von vorn. Das Kommunistische Manifest ist nämlich nicht nur ein politisches Pamphlet, das weitestverbreitete der Welt übrigens, nicht nur ein Stück deutscher Prosa von klassisch-ästhetischer Qualität, sondern auch die Summe fünfjähriger Gedankenarbeit zweier Gesellschaftstheoretiker von hohen Graden, die ihrerseits auf den Schultern bedeutender Denker vor ihnen standen.«
Hermann Klenner (aus: Marxistische Rechtsphilosophie – auf dem Abstellgleis der Weltgeschichte?, in: Das Manifest – heute, VSA-Verlag, S. 192)
»Das Manifest – scheuen wir uns nicht, dies zu wiederholen – ist ein Programm, also ein politischer oder eher ein theoretisch-politischer Text. Es gibt den Auftakt zu einer neuen literarischen Gattung. Es macht den Kommunismus manifest, wie man die Wahrheit manifestiert. Von Intellektuellen (als Militanten) verfaßt, wendet es sich an Militante (als Intellektuelle) und geht folglich die einen wie die anderen an. […] Das Manifest war das erste Werk, das in untrennbarer Verbindung von kritischem Denken und Veränderungswillen eine Alternative zum Kapitalismus aufweist. Anderthalb Jahrhunderte später ist es noch immer das einzige.«
Georges Labica (aus: Welche theoretischen und praktischen Erkenntnisse bleiben, in: Das Manifest – heute, VSA-Verlag, S. 89)

»Wenn wir heute an die Aufgabe herantreten, unser Programm zu besprechen und es anzunehmen, so liegt dem mehr als der formale Umstand zugrunde, daß wir uns gestern als eine selbständige neue Partei konstituiert haben und daß eine neue Partei offiziell ein Programm annehmen müsse; der heutigen Besprechung des Programms liegen große historische Vorgänge zugrunde, nämlich die Tatsache, daß wir vor einem Moment stehen, wo das sozialdemokratische, sozialistische Programm des Proletariats überhaupt auf eine neue Basis gestellt werden muß. Parteigenossen, wir knüpfen dabei an den Faden an, den genau vor 70 Jahren Marx und Engels in dem Kommunistischen Manifest gesponnen hatten.«
Rosa Luxemburg (aus: Rosa Luxemburg, Gesammelte Werke, Bd. 4, S. 486–511)
»Andererseits ist das Manifest – und das ist nicht die geringste seiner bemerkenswerten Eigenschaften – ein Dokument, das auch sein Scheitern ins Auge gefasst hat. Es versprach sich von der kapitalistischen Entwicklung eine »revolutionäre Umgestaltung der ganzen Gesellschaft«, schloß jedoch, wie wir gesehen haben, die Alternative – »den gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klassen«- nicht aus. Viele Jahre später formuliert eine andere Marxistin dies um, als Wahl zwischen Sozialismus und Barbarei. Welche dieser Alternativen den Sieg davontragen wird, ist eine Frage, deren Antwort dem 21. Jahrhundert vorbehalten bleiben muß.«
Eric Hobsbawm (aus: Das Kommunistische Manifest, in: Das Manifest – heute, VSA-Verlag, S. 27)
Auch Lenin findet im Manifest »neben einer Darlegung der allgemeinen Grundlagen des Marxismus bis zu einem gewissen Grade ein Spiegelbild der damaligen konkreten revolutionären Situation« (LW 25, 413). Er hebt hervor, das Manifest gebe »bereits eine geschlossene, systematische, bis heute unübertroffene Darlegung« der Lehre von der weltgeschichtlichen Rolle des Proletariats (aus: LW 18, 576).
»Obwohl Marx und Engels das Manifest schon 1872 als ein »geschichtliches Dokument« sahen, an dem zu ändern und das zu aktualisieren sie nicht mehr das Recht hätten, hat Engels doch in späteren Vorreden betont, daß die Grundgedanken des Manifests richtig und die darin skizzierte »gründliche Einsicht in die wahren Bedingungen der Arbeiteremanzipation« nach wie vor gültig sei. So gültig, daß die »Zahl der in der Landessprache verbreiteten Exemplare des Manifests« einen ziemlich genauen Maßstab für den »Entwicklungsgrad der großen Industrie in jedem Land« abgäbe. Das halte ich für eine gut gemeinte Übertreibung. Allerdings kann und darf man die Verbreitung des Manifests sowie weiterer Schriften seiner Verfasser in einem Land sehr wohl als Indiz nehmen: als Indiz für den Grad des Bewußtseins, daß auch 150 Jahre danach noch vieles, wenn nicht das meiste faul ist im Reich des real existierenden Kapitalismus.«
Michael Krätke (aus: 150 Jahre danach, in: Das Manifest – heute, VSA-Verlag, S. 61)
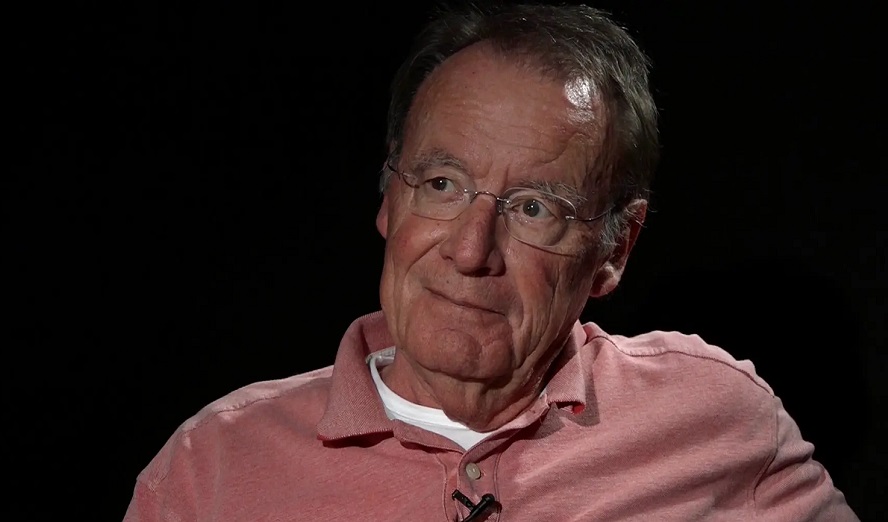
»Die ganze Welt ist geworden, wie Marx und Engels sie in ihrem Manifest der Kommunistischen Partei gemalt haben. Die ganze Welt? Nein! Ein von unbeugsamen Ariern bevölkertes Dorf hört nicht auf, der Zivilisation Widerstand zu leisten, und weigert sich, seine »spießbürgerliche Wehmut« vorschriftsmäßig in dem »eiskalten Wasser egoistischer Berechnung« zu ertränken.«
Hermann L. Gremliza (aus: Haupt- und Nebensätze, Suhrkamp , 2016,
»Das Kommunistische Manifest ist nur das: ein Manifest. Es ist keine lange, umfassende, gelehrte Studie, sondern die öffentliche Verkündung eines politischen Programms, eine kurze, dramatische Zielangabe und ein Kampfaufruf, verfaßt in einer Zeit politischer Gärung, unmittelbar vor einem Geschehen, das einer internationalen Revolution so nahekam wie nie zuvor in der Welt.
Doch die Nachwelt hat dieses politische Manifest nicht bloß als Manifest bewertet. In den anderthalb Jahrhunderten seit seiner Veröffentlichung wurde es nicht nur als Dokument von einzigartigem Einfluß auf Theorie und Praxis revolutionärer Bewegungen in aller Welt, sondern auch als Geschichtswerk, als ökonomische, politische und kulturelle Analyse und als Prophezeiung beurteilt. Das Manifest galt als Rechenschaftslegung über Vergangenes, Gegenwärtiges und Künftiges. – nicht nur für Zeit und Zukunft seiner Verfasser, sondern auch für alle nachfolgenden Generationen einschließlich der unseren.«
Ellen Meiksins Wood (aus: Die Geschichte ist nicht zu Ende, in: Das Manifest – heute, VSA-Verlag, S. 90)
»Marx und Engels haben kein Handbuch hinterlassen, wie Aufbegehren und Widerstand zu organisieren seien. Das Subjekt ihrer Zukunftsprojektion ist das kapitalistische Industrieproletariat. Dieses Subjekt gibt es in der ihnen bekannten Gestalt kaum mehr. Die Subsumierung aller Armen, Ausgebeuteten und Arbeitslosen auf der Welt unter »workers« trägt nicht weit. Eher verführt sie dazu, Verhaltensweisen, Kampfentschlossenheit, Strategie und Taktik vergangener Kämpfe in die gegenwärtigen zu kopieren, was der uneindeutigen Gemengelage nicht angemessen ist. Zukunft ist immer offen. Der Beitrag des Manifests für die Gestaltung menschlicher Verhältnisse bleibt mutatis mutandis aktuell: Zum einen setzt die Globalisierung des Kapitals die im Manifest prognostizierte Auflösung aller bisherigen ökonomischen und sozialen Verhältnisse, kulturellen und moralischen Werte, Ideale und Normen fort. Der Differenziertheit dieses Prozesses entspricht die Vielfalt der Mittel und Methoden, Organisationsformen und Zielsetzungen der davon Betroffenen. Die fortwährende Verwandlung von Produktivkräften in Destruktivkräfte kann nur durch deren gemeinschaftliche Handhabung verhindert werden. Das Manifest endet mit dem Aufruf zur weltweiten Vereinigung der Proletarier. Wenn es diese im Sinne des 19. Jh. auch nicht mehr gibt, ist doch die Notwendigkeit von Widerstand im Weltmaßstab von ungebrochener Aktualität.«
Thomas Marxhausen (aus: HKWM 7/II, 2010, Spalten 1354-1374)

»Was bleibt nach 150 Jahren vom Manifest? Manche Stellen oder Argumente waren schon zu Lebzeiten ihrer Verfasser überholt, wie sie selbst in ihren zahlreichen Vorworten anerkannten. Andere wurden es im Lauf unseres Jahrhunderts und erfordern eine kritische Durchsicht. Aber das allgemeine Anliegen des Dokument, sein zentraler Kern, sein Geist – es gibt etwas wie den »Geist« eines Textes – hat nichts von seiner Kraft und Vitalität verloren.
Dieser Geist resultiert aus seiner kritischen und zugleich emanzipatorischen Qualität, das heißt aus der unauflöslichen Einheit zwischen der Analyse des kapitalismus und dem Aufruf zu seinem Sturz, zwischen dem Stadium des Klassenkampfes und dem Einsatz auf seiten der Klasse der Ausgebeuteten, zwischen des scharfsinnigen Untersuchungen der bürgerlichen Gesellschaft und der revolutionären Utopie einer solidarischen und egalitären Gesellschaft, zwischen der realistischen Darstellung der kapitalistischen Expansionsmechanismen und dem ethischen Anspruch, »alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Menschen ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist«.
Michael Löwy (Globalisierung und Internationalismus, in: Das Manifest – heute, VSA-Verlag, S. 112)

Und sogar Liberale reden noch heute über das Manifest. So auch der Professor für Politische Theorie Urs Marti-Brander in einem Interview mit dem Deutschlandfunk Kultur und Christian Lindner über die Aktualität des Manifest. Beschränktes Denken inklusive:
»Deutschlandfunk Kultur: Wäre Karl Marx vielleicht sogar zufrieden mit den Entwicklungen? Würde er sie, so wie Herr Lindner sie beschrieben hat, als Fortschritt im Sinne des Individuums und der Freiheit des Individuums, der Selbstbestimmung des Individuums begreifen können?
Urs Marti-Brander: Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen: Ja und Nein. Ja aus den Gründen, die Herr Lindner bereits angesprochen hat: Das Kommunistische Manifest ist ja ein Loblied auf den Kapitalismus. Das muss man wirklich so sehen. Und es ist auch ein Bekenntnis zum Liberalismus. Hier darf ich als Schweizer vielleicht eine kleine Geschichte anfügen: Es gibt ja im Kommunistischen Manifest diese verschiedenen Vorschläge, mit welchen politischen Kräften man sich verbinden soll. Da heißt es, »in der Schweiz werden wir uns mit den Liberalen verbünden«, also das, was quasi in Deutschland die FDP wäre.
(https://www.deutschlandfunkkultur.de/zur-aktualitaet-von-karl-marx-5-das-kommunistische-manifest-100.html)
Doch was bleibt? Selbst bei dieser stark eingeschränkten Bandbreite an Äußerungen wird klar: Dieses knappe Pamphlet scheint seine magische Anziehungskraft nie verloren zu haben. Nun liegt es an uns, unsere Ketten zu verlieren und eine Welt für uns zu gewinnen.
Wer erneut oder zum ersten Mal in den Bann des Manifest gezogen werden möchte, dem sei die Teilnahme am nächsten Roten Salon ausdrücklich zu empfehlen.
Am Montag, 15.09.2025 um 18 Uhr 30, liest im ROTEN SALON HAMBURG die Schauspielerin Iris Minich aus dem »Kommunistischen Manifest« von Karl Marx und Friedrich Engels. Die Veranstaltung mit musikalisch performativer Begleitung durch JAJAJA (Iris Minich, Arvild J. Baud) findet im Vortragsraum der Staats- und Universitätsbibliothek an der Uni Hamburg statt.